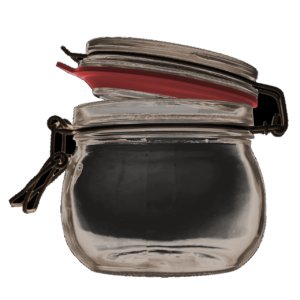Ernährungsmythen zu Obst, Gemüse und Kräutern, die oft im Kleingarten angebaut werden.
OBST
Mythos 1: “Äpfel enthalten mehr Vitamine in der Schale, deshalb darf man die Schale nie entfernen.”
Erklärung:
Die Schale von Äpfeln enthält zwar mehr Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe als das Fruchtfleisch, aber der Vitamin-C-Gehalt ist im Fruchtfleisch sogar oft höher. Es stimmt dennoch, dass die Schale wertvolle Nährstoffe bietet, aber nur, wenn der Apfel nicht mit Pestiziden belastet ist.
Mythos 2: “Reife Bananen sind ungesünder, weil sie zu viel Zucker enthalten.”
Erklärung:
Es stimmt, dass der Zuckeranteil in reifen Bananen höher ist, weil Stärke in Zucker umgewandelt wird. Das macht sie jedoch nicht “ungesund”, sondern lediglich energiereicher. Reife Bananen eignen sich hervorragend als schnelle Energiequelle, z. B. beim Sport.
Mythos 3: “Erdbeeren sind schlecht für Diabetiker, weil sie sehr viel Zucker enthalten.”
Erklärung:
Erdbeeren enthalten tatsächlich nur wenig Zucker (ca. 5 g pro 100 g) und haben eine niedrige glykämische Last. Für Diabetiker sind sie daher in moderaten Mengen völlig unproblematisch.
Mythos 4: “Zitronen sind sauer und daher ungesund für den Magen.”
Erklärung:
Zitronen schmecken sauer, wirken im Körper jedoch basisch, da die Zitronensäure während des Stoffwechsels abgebaut wird. Sie fördern die Verdauung und sind nicht schädlich für den Magen, solange sie in Maßen konsumiert werden.
Mythos 5: “Kirschkerne sind giftig und müssen sofort entfernt werden.”
Erklärung:
Kirschkerne enthalten Amygdalin, das Blausäure freisetzen kann, wenn die Kerne zerbissen werden. In intakter Form sind sie jedoch unproblematisch und passieren den Verdauungstrakt unverändert. Es ist kein Problem, sie versehentlich zu verschlucken.
Mythos 6: “Himbeeren sind schlechter für die Gesundheit, wenn sie kleine Käfer enthalten.”
Erklärung:
Die in Himbeeren manchmal vorkommenden kleinen Käfer sind harmlos und stellen keine Gesundheitsgefahr dar. Es ist lediglich eine Frage der Hygiene und Ästhetik. Mit Wasser lassen sich die meisten Insekten einfach entfernen.
Gemüse
Mythos 7: “Spinat enthält extrem viel Eisen und macht stark, wie Popeye.”
Erklärung:
Dieser Mythos entstand durch einen Kommafehler in einer alten Studie. Spinat enthält zwar Eisen, aber nicht außergewöhnlich viel. Außerdem wird das Eisen aus Spinat schlechter aufgenommen als aus tierischen Quellen.
Mythos 8: “Karotten sind roh gesünder als gekocht.”
Erklärung:
Karotten enthalten Beta-Carotin, das vom Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Gekochte Karotten geben Beta-Carotin jedoch besser frei, weil die Zellstrukturen durch die Hitze aufgebrochen werden. Ein Schuss Fett macht die Aufnahme noch effizienter.
Mythos 9: “Tomaten verlieren beim Kochen alle Vitamine.”
Erklärung:
Es stimmt, dass ein kleiner Teil der hitzeempfindlichen Vitamine verloren geht. Allerdings wird beim Kochen der Gehalt an Lycopin (ein starkes Antioxidans) deutlich erhöht, was die Nachteile überwiegen kann.
Mythos 10: “Rhabarberstangen im Sommer werden giftig.”
Erklärung:
Rhabarber enthält Oxalsäure, deren Gehalt in den Stangen mit der Reife steigt. Im Sommer sind die Stangen zwar saurer, aber in normalen Mengen weiterhin unbedenklich. Nur die Blätter sind wegen ihres hohen Oxalsäuregehalts wirklich giftig.
Mythos 11: “Zwiebeln und Knoblauch sind roh immer gesünder als gekocht.”
Erklärung:
Der gesundheitlich wertvolle Stoff Allicin in Zwiebeln und Knoblauch entsteht durch das Zerkleinern der Knolle, ist jedoch hitzeempfindlich. Kochen reduziert den Allicin-Gehalt, macht jedoch andere Stoffe, wie Antioxidantien, besser verfügbar. Beide Varianten haben also Vor- und Nachteile.
Mythos 12: “Kartoffeln mit grünlichen Stellen sind völlig ungenießbar.”
Erklärung:
Die grünen Stellen in Kartoffeln enthalten Solanin, ein giftiger Stoff. Es reicht jedoch aus, die grünen Stellen großzügig wegzuschneiden. Die restliche Kartoffel kann bedenkenlos gegessen werden, solange sie nicht stark grün verfärbt ist.
Mythos 13: “Paprika verliert ihre Vitamine, wenn sie gebraten wird.”
Erklärung:
Ähnlich wie bei Tomaten geht ein Teil hitzeempfindlicher Vitamine (z. B. Vitamin C) beim Braten verloren, aber der Gehalt an anderen gesundheitsfördernden Stoffen wie Antioxidantien bleibt erhalten oder wird sogar verbessert.
Kräuter
Mythos 14: “Lavendel in der Küche hat keine Wirkung – er dient nur als Deko.”
Erklärung:
Lavendel hat tatsächlich viele Wirkstoffe, z. B. beruhigende ätherische Öle. In der Küche kann er nicht nur zur Aromatisierung von Zucker oder Desserts verwendet werden, sondern auch als Heilkraut in Tees gegen Schlaflosigkeit und Unruhe.
Mythos 15: “Rosmarin wird beim Kochen bitter.”
Erklärung:
Rosmarin wird beim Kochen nicht automatisch bitter, solange er nicht verbrannt wird. Das Aroma entfaltet sich sogar besser, wenn man die Zweige in Schmorgerichten oder beim Backen von Kartoffeln mitgart.
Mythos 16: “Schnittlauch darf nicht blühen, sonst ist er ungenießbar.”
Erklärung:
Schnittlauch ist auch während der Blüte essbar. Die Blüten haben ein mildes Zwiebelaroma und eignen sich sogar hervorragend als essbare Dekoration oder als Zutat in Salaten.
Mythos 17: “Thymian darf nie zu lange erhitzt werden, da er seine Wirkstoffe verliert.”
Erklärung:
Thymian ist eines der Kräuter, das beim Kochen nicht an Wirkung verliert, sondern seine ätherischen Öle freisetzt. Gerade bei lang gekochten Gerichten wie Suppen oder Eintöpfen ist Thymian eine ideale Zutat.
Mythos 18: “Frische Kräuter sind immer besser als getrocknete.”
Erklärung:
Frische Kräuter enthalten mehr Wasser und flüchtige Aromen. Getrocknete Kräuter können jedoch konzentriertere Aromen und teilweise sogar höhere Anteile bestimmter sekundärer Pflanzenstoffe aufweisen. Der Nährstoffgehalt ist also nicht immer schlechter.
Mythos 19: “Petersilie darf nicht mitgekocht werden, weil sie dadurch giftig wird.”
Erklärung:
Dieser Mythos ist falsch. Petersilie verliert beim Kochen zwar einen Teil ihres Aromas und hitzeempfindlicher Nährstoffe, wird aber keinesfalls giftig.
Mythos 20: “Basilikum sollte niemals eingefroren werden, weil es seine Wirkstoffe verliert.”
Erklärung:
Basilikum verliert durch Einfrieren lediglich etwas Aroma und Struktur, aber keine wichtigen Nährstoffe. Einfrieren ist eine gute Methode, um Basilikum haltbar zu machen.
![[Parzelle 61]](https://parzelle61.de/wp-content/uploads/2024/04/parzelle61.png)