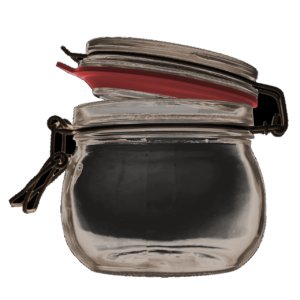Welche Gemüsepflanzen gibt es in Deutschland in diesem Zusammenhang?
Bei Gemüsearten lässt sich grob in einjährige, zweijährige und mehrjährige Pflanzen unterscheiden. Während einjährige Pflanzen, wie Tomaten oder Zucchini, im Herbst vergehen, bieten zweijährige und mehrjährige Pflanzen die Möglichkeit, den Garten auch in der kalten Jahreszeit produktiv zu nutzen. Hier ist eine detaillierte Übersicht über gängige zweijährige und mehrjährige Gemüsepflanzen in Deutschland, einschließlich Anbau-, Pflege- und Überwinterungstipps.
Zweijährige Gemüsepflanzen
Zweijährige Pflanzen wachsen im ersten Jahr, überwintern und blühen im zweiten Jahr. Sie können daher das Winterhalbjahr nutzen, um Energie für das kommende Jahr zu sammeln und lassen sich oft gut im Garten lassen.
- Winterharter Lauch (Porree)
- Aussaat: Frühling bis Frühsommer direkt ins Beet oder in Töpfen vorziehen.
- Pflege: Benötigt regelmäßige Bewässerung und Düngung (Stickstoffreicher Dünger).
- Überwinterung: Winterharter Lauch kann gut im Beet bleiben, auch bei Frost. Ein Abdecken mit Stroh oder Mulch schützt vor extremer Kälte.
- Tipp: Blanchieren der Stängel kann den Geschmack verbessern. Dazu einfach den Boden um die Pflanzen herum leicht anhäufeln.
- Pastinaken
- Aussaat: Frühling direkt ins Freiland.
- Pflege: Lockerer Boden und regelmäßige Wassergaben sind wichtig.
- Überwinterung: Pastinaken können im Boden verbleiben und sogar im Winter geerntet werden. Die Kälte verstärkt ihren süßlichen Geschmack.
- Mythos: Pastinaken sollen bei strengem Frost ungenießbar werden – das Gegenteil ist der Fall. Frost verbessert den Geschmack.
- Wurzelpetersilie
- Aussaat: März bis Juni, direkt ins Freiland.
- Pflege: Boden muss gut gelockert sein, mittlerer Wasserbedarf.
- Überwinterung: Im Boden lassen und bei Bedarf ernten. Wie bei Pastinaken verbessert Frost die Qualität der Wurzel.
Mehrjährige Gemüsepflanzen
Mehrjährige Gemüsesorten treiben jährlich wieder aus und bieten eine langfristige Ernteperspektive. Sie sind ideal für pflegeleichte Gärten und reduzieren die jährlichen Neupflanzungsarbeiten.
- Schnittlauch
- Aussaat: Frühling oder Herbst.
- Pflege: Schnittlauch benötigt einen durchlässigen Boden und regelmäßige Wassergaben.
- Überwinterung: Schnittlauch ist winterhart und kann im Beet bleiben. Es empfiehlt sich, ihn im Herbst zurückzuschneiden und leicht zu mulchen.
- Rhabarber
- Aussaat: Meist durch Teilung der Wurzelknollen im Herbst oder Frühjahr.
- Pflege: Rhabarber benötigt nährstoffreichen Boden und regelmäßige Wassergaben.
- Überwinterung: Blätter im Herbst abschneiden und eine Schicht Mulch aufbringen.
- Mythos: Rhabarber kann im Winter geerntet werden – dies ist ein Irrtum. Die Ernte erfolgt idealerweise nur im Frühling bis Mitte Juni.
- Meerrettich
- Aussaat: Am besten durch Wurzelstecklinge, entweder im Herbst oder Frühjahr.
- Pflege: Meerrettich braucht tiefgründigen Boden und gedeiht am besten in sonniger Lage.
- Überwinterung: Die Pflanze bleibt im Beet, Ernte erfolgt bei Bedarf. Um das Aroma zu intensivieren, erntet man Meerrettich idealerweise im Spätherbst.
- Spargel
- Aussaat: Anbau durch Setzlinge im Frühling, erste Ernte ab dem dritten Jahr.
- Pflege: Sehr pflegeintensiv, hohe Düngergaben und regelmäßig Wasser notwendig.
- Überwinterung: Spargel ist mehrjährig winterhart und wird im Herbst zurückgeschnitten. Eine Mulchschicht hilft, die Triebe vor starker Kälte zu schützen.
- Topinambur
- Aussaat: Pflanzung der Knollen im Frühjahr.
- Pflege: Wenig anspruchsvoll, gelegentliches Düngen und wässern.
- Überwinterung: Knollen können im Boden verbleiben und bei Bedarf ausgegraben werden, da sie frosthart sind.
Überwinterungstipps und Mythen
- Mulch als Frostschutz: Eine Mulchschicht aus Laub oder Stroh isoliert den Boden und schützt die Pflanzenwurzeln vor starkem Frost.
- Ernten im Winter: Viele Wurzelgemüse wie Möhren, Pastinaken und Sellerie können im Winter geerntet werden. Kälte intensiviert oft das Aroma.
![[Parzelle 61]](https://parzelle61.de/wp-content/uploads/2024/04/parzelle61.png)